02.12.2022 I Kinder haben das Recht auf Beratung
Die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle wendet sich an Mütter, Väter, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren. Bisher kamen Minderjährige in der Regel auf Anregung der Eltern in die Riemerschmidstraße 16. Seit der Novellierung von § 8 SGB VIII haben sie auch das Recht, das Beratungsangebot ohne deren Wissen oder Erlaubnis zu nutzen. Wie aber wirkt sich die Ermächtigung auf die Erziehenden aus? Und was folgt daraus für die Beratenden?
Eine Gesetzesnovelle und ihre Umsetzung
Eine, die ständig mit diesem Thema zu tun hat, ist Sozialpädagogin Kathrin Wellisch. Sie ist Teil desTeams der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle und zugleich aufsuchend an zwei Grundschulen im Stadtbezirk Feldmoching-Hasenbergl tätig. „EB an Grundschulen“ heißt das 2021 initiierte Angebot, mit dem auf niederschwellige Weise neue Zielgruppen erreicht werden sollen. Die Schule wird dabei als vertrauter Raum genutzt und direkt in der Lebenswelt der Kinder angesetzt. Immer mehr Mädchen und Jungen nutzen die Chance und vertrauen der Sozialpädagogin ihre Sorgen und Nöte an. Nicht selten handelt es sich dabei um familiäre Probleme, bei denen sie Hilfe suchen. „Nicht zu wissen, was die Tochter oder der Sohn einer unbekannten Person erzählt ist für Väter und Mütter oft schwer auszuhalten“, erzählt Kathrin Wellisch. „Und auch für uns ist diese neue Auftragsbeziehung häufig eine Gratwanderung: Einerseits sind wir – wie bei erwachsenen Klientinnen und Klienten – an die Schweigepflicht gebunden und dürfen uns mit niemandem darüber austauschen, sofern wir keine ausdrückliche Erlaubnis dafür haben. Andererseits müssen wir abwägen, ab welchem Zeitpunkt wir eine Einbindung der Eltern anregen oder vielleicht sogar einfordern müssen.“ Dies ist der Fall, wenn eine Lösung des Problems nur über das gesamte Familiensystem möglich ist und absolut unerlässlich, sobald eine Gefährdung des Kindeswohls im Beratungsverlauf erkennbar wird.
In die Familienberatungsstelle kommen Kinder und Jugendliche leider viel zu selten aus eigenem Antrieb. Entweder wissen sie noch gar nicht, dass es dieses Angebot gibt, dass sie darauf – ebenso wie ihre Eltern – einen gesetzlichen Anspruch haben und dass sie nichts für die Beratung bezahlen müssen. Oder sie haben Scheu vor dem Schritt, sich Fremden gegenüber im unvertrauten Raum zu öffnen und mit ihnen über Themen zu reden, die sie in ihrem Innersten bewegen und belasten. Stark frequentiert ist dagegen das anonyme Beratungsangebot über bke-jugendberatung.de, an dem sich auch die Einrichtung in der Riemerschmidstraße beteiligt. Aus ganz Deutschland kommen die 14- bis 21-Jährigen, die dort an Einzel-, Gruppen- und Themenchats oder speziellen Foren mit Oliver Freiling, dem stellvertretenden Leiter der EB, teilnehmen. „Wir stellen ebenso wie andere Beratungsstellen fest, dass klassische Komm-Strukturen heute nicht mehr ausreichen, um die Vielzahl der Klient*innen in ihren Bedürfnissen zu erreichen und abzuholen“, meint der Psychologe. „Bei den einen sind mobile oder zeitliche Einschränkungen der Grund. Bei vielen anderen ist es die Angst vor Beschämung oder davor, über das eigentliche Bedürfnis hinaus belehrt oder gar bedrängt zu werden.“ Um diese Hemmschwelle, die online weniger stark empfunden wird, auch im echten Leben zu überwinden, ist aufsuchende Beratung – zum Beispiel in Kitas, in Schulen oder direkt in den Familien – häufig besser geeignet. Vor allem aber ist wichtig, Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe zu begegnen, ihre Bewältigungsstrategien anzuerkennen und so zu erweitern, dass ein gelingendes Heranwachsen möglich wird. Denn genau das ist das Ziel der Gesetzesnovelle.
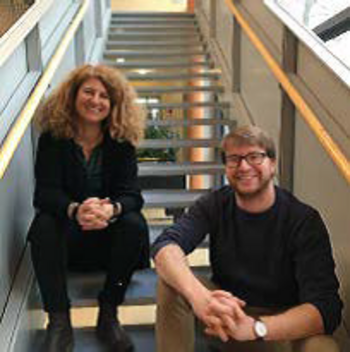
Kathrin Wellisch und Stefan Redler sind die beiden Ansprechpersonen der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle vor Ort an den Grundschulen.